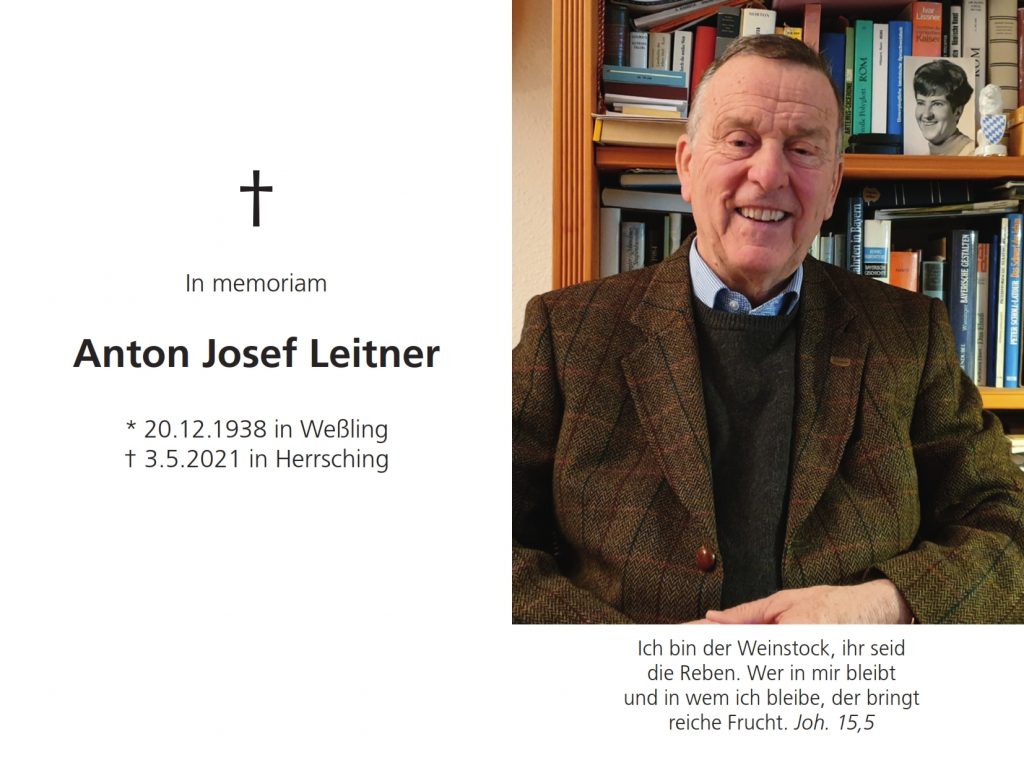Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie,
heuer habe ich für Sie / für Euch als Weihnachts- und Silvestergruß kein klassisches Weihnachtsgedicht ausgesucht, aber trotzdem einen absoluten Lyrik-Klassiker, der auch sehr gut zu diesen besonderen Tagen im Jahr passt und unsere aktuelle Großwetterlage trifft: Friedrich Schillers berühmtes Hoffnungs-Gedicht.
Ich glaube, ich muss niemanden erklären, wie bitternötig für uns alle in diesen Zeiten, die selbst einen lebensbejahenden Optimisten wie mich in die Verzweiflung treiben können, die Hoffnung ist. Ein Glück: Sie stirbt bekanntlich zuletzt. Und das gilt auch, wenn, wie gerade, an vielen Orten in der Welt Menschen mit Gewalt um ihr Leben und um ihr meist mühsam erworbenes Hab und Gut gebracht oder gebombt werden, wenn sie zittern müssen, während ich relativ beschützt diese Zeilen verfasse.
Draußen wütet ein Sturm (wir haben gerade den Abend des 21. Dezember, als ich diese Zeilen hier schreibe), und sein Wüten scheint mir symptomatisch für dieses zu Ende gehende Jahr 2023, das zu den schwersten Jahren zählt, die ich als Klein-Verleger und Lyrikvermittler in den gut vier Jahrzehnten meiner Tätigkeit erlebt habe. Während weltweit immer mehr Menschen mit dem Finger am Abzug an die Macht gelangen, Menschen, die Gewalt, Massenmorde und Krieg als selbstverständliche Mittel zum Durchsetzen ihrer Expansions-Politik betrachten, gewinne ich hierzulande zunehmend den Eindruck, dass unsere Politikerinnen und Politiker verstärkt all jene bedienen, die am lautesten schreien. Bisweilen scheint es mir so, als ob die politischen Repräsentanten hierzulande ihr aktives Handeln immer stärker nach den beiden Prinzipien »Was scheren mich meine Versprechen von gestern?« und »Heute so, morgen so« gestalten. Ja, mitunter handeln sie exakt andersherum, als sie es vorher angekündigt oder versprochen haben.
Alle reden von der Notwendigkeit der Entbürokratisierung, aber ich habe in meinen 32 Jahren der Selbstständigkeit nie mehr bürokratische Schikanen erleben müssen als im Jahr 2023. Die EU und ihr Musterschüler Deutschland bürokratisieren sich langsam, aber sicher in die schiere Unbeweglichkeit.
Wer zum Beispiel zwei fast 30 Jahre alte Gasheizungen in Betrieb hat wie wir, und wer seit zwei Jahren auf Wärmepumpen, Photovoltaik und Elektromobilität umrüsten will, wie ich, der weiß oder ahnt, was ich allein in dieser Hinsicht erlebe und durchmachen muss. Eigentlich kann man diesen ganzen Wahnsinn, der ständig von der Politik im Bereich der Förderungen verändert wird, nur noch mit Humor verfolgen oder eben mit der lebenslänglichen Hoffnung, um die Friedrich Schiller in seinem gleichnamigen Gedicht kreist.
Und dass man die Hoffnung nie aufgeben soll, das habe ich einmal mehr im Jahr 2023 erfahren dürfen. Ich hatte mir hier begründete Hoffnung auf einen Literaturpreis gemacht, der, was seine Strahlkraft und Dotierung betrifft, eher zu den kleineren Preisen gehört. Diese eine Hoffnung wurde zwar enttäuscht, aber dafür wurde ich an anderer Stelle wesentlich reicher belohnt: nämlich mit der Verleihung des vielfach höher dotierten und bedeutenderen Deutschen Verlagspreises 2023 – die mich so überraschte wie ganz besonders freute, hatte mein Verlag ihn doch auch schon im Vorjahr 2022 erhalten.
Insofern, durch etwa dieses Beispiel ermutigt, werde ich aus gutem Grund selbst weiterhin ein Hoffender bleiben. Und ich werde auch künftig darauf hoffen, dass die Despoten und Kriegstreiber dieser Welt doch einmal dort landen, wo sie hingehören, nämlich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, und dass wir uns eines Tages auch hierzulande wieder auf das Wort eines Politikers verlassen können, etwa wenn er verspricht, dass kein Kleinbetrieb seine Corona-Soforthilfen zurückbezahlen muss und sie dann einige Jahre später kaltschnäuzig zurückfordern lässt, wenn seine Kassen plötzlich riesige Löcher aufweisen …
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen / Euch und mir, dass 2024 manche Hoffnungen von uns auch wirklich eingelöst werden und dass unsere geschundenen und terrorisierten Mitmenschen in der Ukraine, in Israel und auch jene Teile der Bevölkerung in Palästina, die mit Terror nichts am Hut haben, wieder in Ruhe und Frieden leben dürfen. Ein vermutlich utopischer Wunsch, aber wenigstens hoffen dürfen wir.
Und für Sie und Euch und uns alle hoffe ich jedenfalls das Beste. Habt friedvolle Feiertage, kommt gut ins neue Jahr 2024 und bleibt mir und unserer Zeitschrift DAS GEDICHT, unserem Blog www.dasgedichtblog.de und der Poesie insgesamt verbunden.
Toi, toi, toi,
alles erdenklich Gute
Ihr Anton G. Leitner
in der Hoffnung auf ein Wiedersehen
und Wiederhören im Jahr 2024!
***
Friedrich Schiller
Hoffnung
Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen,
Nach einem glücklichen, goldenen Ziel
Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.
Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
Sie umflattert den fröhlichen Knaben,
Den Jüngling locket ihr Zauberschein,
Sie wird mit dem Greis nicht begraben;
Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf,
Noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung auf.
Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn,
Erzeugt im Gehirne des Toren.
Im Herzen kündet es laut sich an:
Zu was Besserm sind wir geboren;
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.